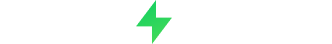Sehr geehrte Damen und Herren,
im Bundestag wurde letzte Woche das Gesetz zur Befugniserweiterung und Entbürokratisierung in der Pflege verabschiedet. Damit werden die Kompetenzen von Pflegefachkräften erweitert und die Pflege umfassend entbürokratisiert. Das Gesetz bedarf keiner Zustimmung des Bundesrates.
„Pflegekräfte können viel mehr als sie bislang dürfen! Zurecht erheben sie die Forderung nach mehr Befugnissen entsprechend ihrer tatsächlichen Kompetenzen. Die Versorgung muss auf mehr Schultern verteilt werden – dabei leisten Pflegekräfte einen unersetzlichen Beitrag. Wir wollen mehr Menschen für diese Aufgaben begeistern und alle stärken, die sich für diesen Beruf entschieden haben. Mehr Befugnisse erhöhen die Attraktivität, weniger Bürokratie schafft mehr Freiräume: Denn jede Minute, die sich eine Pflegekraft nicht mit Bürokratie beschäftigt, ist eine gewonnene Minute für die Versorgung am Menschen“ sagt Bundesgesundheitsministerin Nina Warken.
Die wesentlichen Auswirkungen des Gesetzes auf Pflegeeinrichtungen finden Sie hier:
Chancen für Pflegeeinrichtungen
- Mehr Handlungsspielraum für Pflegefachpersonen
- Pflegefachpersonen erhalten künftig erweiterte Befugnisse, z. B. zur eigenverantwortlichen Heilkunde-Ausübung und zur Übernahme bisher ärztlich vorbehaltenener Leistungen nach ärztlicher Erstdiagnose beziehungsweise bei pflegerischer Diagnosestellung.
- Damit können Einrichtungen Prozesse beschleunigen: Weniger Arzt-Anforderungen, mehr Kompetenz beim Pflegepersonal.
- Dies kann die Attraktivität der Einrichtung steigern (professionelleres Berufsbild) und Engpässe bei Ärzten oder Verordnungen reduzieren.
- Entbürokratisierung und weniger Dokumentations-/Prüfaufwand
-
- Die gesetzliche Begrenzung der Pflegedokumentation auf das erforderliche Maß sowie explizite Verankerung dieser Begrenzung im Bereich Qualitätsprüfung.
- Prüfungen durch Medizinischer Dienst der Krankenversicherung (MD) und Heimaufsicht sollen besser koordiniert werden, Doppelprüfungen sollen vermieden werden.
- Für ambulante und teilstationäre Einrichtungen mit hohem Qualitätsniveau wird der Prüf-Rhythmus von 1 auf 2 Jahre verlängert.
- Formulare und Anträge für Pflegeleistungen sollen vereinfacht werden.
- Stärkung regionaler Versorgung und Netzwerke
-
- Einrichtungen werden verstärkt in kommunale Pflegeplanung eingebunden: Kommunen erhalten aktuellere Daten, mehr Mitwirkungsmöglichkeiten bei Zulassung und Gestaltung der Versorgung.
- Förderung von innovativen gemeinschaftlichen Wohn- und Versorgungsformen und die Möglichkeit zur vertragsübergreifenden Versorgung zwischen ambulant und stationär.
- Für Einrichtungen bedeutet dies neue Kooperationsformen und Chance zur Diversifikation des Angebots.
- Finanzielle und vertragliche Erleichterungen
-
- Im Pflegevergütungsrecht sollen Verfahren schlanker werden, Melde- und Umsetzungsfristen bei tariflicher Entlohnung sind länger, Meldeverfahren für tarifgebundene Einrichtungen vereinfacht.
- Digital-Pflegeanwendungen (DiPA) werden schneller zugänglich gemacht — Einrichtungen können von neuen Technologien profitieren.
Herausforderungen und Umstellungen für Pflegeeinrichtungen
- Qualifikations- und Kompetenznachweise erforderlich
-
- Nicht jede Pflegefachperson kann automatisch alle neuen Befugnisse übernehmen — Voraussetzung sind entsprechende Kompetenzen, z. B. aus hochschulischer Pflegeausbildung oder staatlich anerkannter Weiterbildung.
- Einrichtungen müssen ggf. Investitionen in Weiterbildung, Schulung und Nachweisführung tätigen.
- Organisation und Prozessanpassung
-
- Veränderungen in den Arbeitsabläufen: Dokumentationspflichten ändern sich, Prüfungen anders terminiert, Kooperations- und Vertragsmodelle (z. B. zwischen ambulant und stationär) werden komplizierter. Einrichtungen müssen sich organisatorisch anpassen (etwa IT-Systeme, Schnittstellen, Verantwortlichkeiten).
- Vorhandene Abläufe müssen überprüft und ggf. neu gestaltet werden.
- Qualitätssicherung bleibt zentral
-
- Obwohl der Prüfrhythmus bei hohem Qualitätsniveau verlängert wird, bleibt die Qualität ein zentrales Kriterium – Einrichtungen müssen weiterhin nachweisen, dass sie „hohes Qualitätsniveau“ haben.
- Änderungen im Prüfverfahren bedeuten, dass Einrichtungen aktiv werden müssen, um die Voraussetzungen zu erfüllen (z. B. digitale Datenkommunikation, Kennzahlen etc.).
- Rechtliche und haftungsrechtliche Aspekte
-
- Wenn Pflegefachpersonen zusätzliche Befugnisse übernehmen, stellt sich die Frage nach Verantwortung und Haftung: Einrichtungen müssen prüfen, wie Aufgaben-Übertragungen rechtlich abgesichert sind (Verträge, Kompetenznachweise, Versicherung, Qualitätssicherung).
- Es kann zusätzliche Anforderungen an das Risikomanagement geben.
- Investitionen und Ressourcenbedarf
-
- Weiterbildung, IT-Anpassungen, Aufbau oder Stärkung regionaler Netzwerke und neue Versorgungsformen bedeuten initiale Aufwände. Einrichtungen sollten dies im Budget berücksichtigen.
- Die Entlastung durch Bürokratie kommt nicht sofort und automatisch – es bedarf eines Übergangs.
Konkrete Auswirkungen
- Vollstationäre Pflegeeinrichtungen: Profitieren vom verlängerten Prüfrhythmus bei hoher Qualität; müssen aber ihre Qualitäts- und Dokumentationsprozesse anpassen. Neue Befugnisse des Pflegepersonals können interne Prozesse (z. B. Wundversorgung, Diabetes-Monitoring) entlasten.
- Ambulante Pflegedienste / teilstationäre Einrichtungen: Ähnlich wie stationär, mit zusätzlicher Chance durch Kooperation mit anderen Versorgungsformen (z. B. gemeinschaftliches Wohnen). Gleichzeitig eventuell größere organisatorische Umstellung im Hinblick auf Vertrags- und Versorgungsmodelle.
Die wichtigsten Regelungen des Gesetzes finden Sie auch HIER.
Für weitere Fragen zu diesem Thema oder unseren Leistungen erreichen Sie uns telefonisch unter 0211 957 423 0 oder per E-Mail unter info@soleo-gmbh.de.
Wir freuen uns auf Ihre Kontaktaufnahme!
Ihre soleo* GmbH